 Susanne Himmelsbach | StudentenPACK.
Susanne Himmelsbach | StudentenPACK. Große Pillen wirken besser, aber Vorsicht: Die zugehörigen Beipackzettel können krank machen!
Vielleicht liegt es an dem Männchen in meinem Kopf, das mir sagt: „Komm mal wieder runter!“. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf die nötigen Hintergrundinformationen zurück greifen kann. Vielleicht war ich bisher auch einfach nur bei guten Ärzten in Behandlung (übrigens nicht wegen der oben aufgeführten Krankheiten!). Doch vielleicht hatte ich einfach nur Glück.
Denn mittlerweile gilt es als erwiesen: Die Erwartung, krank zu werden, kann krank machen. Über dieses Phänomen hat Dr. Magnus Heier das Buch „Nocebo: Wer’s glaubt wird krank“ geschrieben, mit dem charmanten Untertitel „Wie man trotz Gentests, Beipackzetteln und Röntgenbildern gesund bleibt“.
Der Nocebo-Effekt ist bislang in der Bevölkerung weitgehend unbekannt. Dabei wirkt er fast wie sein großer Bruder, der Placebo-Effekt, nur eben in die andere Richtung. Während Patienten, die Placebos einnehmen fest davon ausgehen, dass dieses Medikament sie heilt, kann schon der gleichzeitig ausgegebene Beipackzettel wieder krank machen: Allein das Wissen darüber, dass es Nebenwirkungen gibt, kann diese auslösen – auch wenn von einem Placebo natürlich eigentlich weder Wirkung noch Nebenwirkung ausgehen sollte. Heier hat sich also auf die Suche begeben, wodurch Krankheiten denn entstehen, von den wissenschaftlich bekannten Erregern und Auslösern abgesehen. Und gefunden hat er reichlich: Jedes der insgesamt 20 Kapitel beginnt mit einem Beispiel aus der Praxis. Sei es die Vorstellung, im direkten Strahlungsgebiet einer Handyantenne zu leben. Sei es der verspannte Patient, der durch sein Röntgenbild die Gewissheit bekommt, seine Wirbelsäule sei nicht mehr zu gebrauchen. Oder sei es schlicht eine zu eng bemessene statistische Lebenserwartung, die bei einem Tumorpatienten im gegebenen Zeitrahmen zum Tod führte, ohne dass der Krebs schon so weit fortgeschritten war.
Den Fallbeispielen folgen jeweils verschiedene Beobachtungen Heiers. Manche sind banal: Invasive Eingriffe wirken besser als eine Ernährungsumstellung und eine Spritze wirkt besser als eine Tablette. Das gleiche Mittel durch den Arzt appliziert heilt besser als „nur“ von der Schwester. Gespickt sind diese Beobachtungen immer wieder mit Ergebnissen aus der Forschung, von Placebo- und MRT-Studien beispielsweise. Dabei sind Fachbegriffe auch in einzelnen Infoboxen für den medizinischen Laien gut verständlich erklärt. Doch das Buch ist sicher auch nicht nur für den Laien geschrieben, denn manchen Fachmann sollte es doch zumindest nachdenklich stimmen. Immer wieder betont Heier, wie wichtig es ist, gestellte Diagnosen ausreichend zu erklären. Denn ein Patient, dem nicht die Möglichkeit gegeben wird, Fragen zu stellen und die Information unter fachlicher Aufsicht zu verarbeiten, der wird sich seine Welt selbst erklären. Sei es im Freundeskreis oder bei Dr. Google, der verunsicherte Patient wird sich auf die Suche machen – und er wird fündig werden.
Der Gefahr, die von der Selbstaufklärung des Patienten – insbesondere mit Hilfe des Internets – ausgeht, widmet Heier sogar fünf Kapitel. Er rät dringend dazu, einen Patienten der mit ausgedrucktem Infomaterial in die Praxis kommt, nicht genervt zur Seite zu schieben sondern ihm besser selbst Material an die Hand zu geben, das seine Fragen beantwortet und künftig ein Gespräch auf Augenhöhe ermöglicht. Denn wer seine Symptome googelt, wird zunächst entweder auf Seiten stoßen, die von der Pharma-Industrie subventioniert werden oder auf Foren, in denen die buntesten Szenarien mit den erschreckendsten Krankheiten ausgemalt werden. Bei letzteren können zwar die entsprechenden Symptome auftreten, dennoch ist eine Verspannung häufiger als eine Multiple Sklerose – und zudem sehr viel leichter zu behandeln, vorausgesetzt, der Patient geht nicht vom Schlimmsten aus.
Mit einem Augenzwinkern rät der Autor, der selbst nicht nur als Journalist sondern auch als niedergelassener Neurologe tätig ist, übrigens dazu, sich selbst auf dem Laufenden zu halten, was Gesundheitssendungen im Fernsehen und die aktuellen Ausgaben von Apothekenrundschau und Co. zu bieten haben – das Wartezimmer füllt sich erwartungsgemäß mit genau diesen Patienten. Da ist es besser, die richtige Antwort gleich parat zu haben.
Während Heier ausreichend lange Gespräche gepaart mit einer soliden Diagnostik empfiehlt, warnt er aber auch vor zu viel Aktionismus. In einem Fall schreibt er von einer Osteoporose-Patientin, die zur humangenetischen Untersuchung geschickt wurde. Nur wurde nicht spezifisch nach ihrer Krankheit gesucht, sie wurde einmal durch die gesamte Mühle gedreht. Das Ergebnis: Es besteht eine gewisse Gefahr für zig Erbkrankheiten. Was erstmal nur Statistik ist, lässt die Frau nicht mehr schlafen, Heier schreibt von einem „Damokles-Schwert“, das fortan über ihr schwebt. Und so geht es auch anderen, die beispielsweise zu häufig in diverse Röhren geschoben werden. Eine ähnliche Gefahr gehe dem Autor zufolge von den verschiedenen Check-Up-Untersuchungen aus. Diese wurden in jüngster Zeit immer präziser und konnten immer mehr Merkmale herausfiltern. Dabei werden auch Krankheiten gefunden, die vielleicht in der noch verbliebenen Lebensspanne des Untersuchten niemals zum Ausbruch gekommen wären. Doch aufgrund dieses Wissens muss sich der Patient nun mit der Frage auseinander setzen, ob er sich gegen eine Krankheit behandeln lassen will, die er vielleicht sowieso nicht erlebt. Aber eben nur vielleicht. Hier gelte es, ein Feingefühl zu entwickeln und vor allem den Patienten zu beraten. Glück haben übrigens hier ausnahmsweise die Kassenpatienten, so Heier: Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen die meisten Check-Ups und Screenings nämlich nicht. Im Gegensatz zu den privaten, die dann doch von manchem Mediziner gerne in Anspruch genommen werden – mit den oben beschriebenen Ergebnissen.
Besonders beliebt sind bei Magnus Heier offensichtlich Lebensmittelunverträglichkeiten. Jeder Fünfte in der Bundesrepublik scheint eine zu haben, lediglich bei einem Prozent ist das aber auch gesichert. Der Mechanismus ist einfach: Der Darm grummelt, man denkt nach: „Was hab ich gegessen?“ Irgendwo in der Nahrung taucht dann ein milchhaltiges Produkt auf und da man erst neulich etwas über Laktose-Intoleranzen gelesen hat, behält man es im Auge. Nach dem nächsten Glas Milch, dem nächsten Jogurt horcht man intensiv in den eigenen Bauch hinein. War da was? Wer auf die Symptome wartet, wird sie auch bekommen, denn so ein Darm kann schnell mal rumpeln – ein klassischer Nocebo-Effekt. Fortan ist man laktoseintolerant, zumindest im Kopf. Ob das zugehörige Enzym wirklich nicht arbeitet, ist jedoch nur über verblindete Testungen herauszufinden, bei denen der Patient nicht weiß, was er zu sich nimmt und folglich keine Erwartungen hat.
Und während Heier immer mehr Beispiele bringt, lässt sich das Buch eigentlich recht knapp zusammenfassen: Vertrauen in den Arzt fördert die Heilung. Doch bringt auch der Autor es am Ende des Buches noch einmal auf den Punkt: Kurz greift er alle relevanten Aspekte im letzten Abschnitt noch einmal auf und gibt unter der Überschrift „Was tun?“ Tipps, die ein Arzt mit wenig Aufwand aber großem Effekt beherzigen kann. Es sei, so schreibt Magnus Heier, an der Zeit zurück zu kehren. Man müsse erst reden und dann untersuchen.
Während das Buch etwas holprig begonnen und sich einige Fallbeispiele aus dem Vorwort in der ersten Hälfte des Buches stetig wiederholt hatten, nimmt Heier doch mit jeder Seite mehr Fahrt auf. Er schreibt locker und doch eindringlich, öffnet die Augen für eigentlich banale Dinge und liefert gleichzeitig Lösungsansätze. Das Buch ist für beide Seiten des Behandlungstisches geschrieben: Für Arzt und Patienten, die beide am gleichen Strang ziehen sollten.
Bebildert ist das Buch übrigens auch: Mit den „Touché“ Comic-Strips von Thomas Körner, die dem einen oder anderen vielleicht aus der taz bekannt sind. Mit Witz, Charme und einer genau bemessenen Prise Boshaftigkeit macht sich Körner über Ärzte und Patienten her, bei letzteren vor allem über jene, die Mitglieder bei den Anonymen Hypochondern sind.
So konnte ich am Ende das Buch, dem ich zu Beginn leicht skeptisch gegenüber stand, doch mit einem guten Gefühl weglegen: Es hat mich unterhalten, hat ein wenig meine eingebildeten Krankheiten geheilt und mir – so hoffe ich zumindest – auch für meinen Berufsweg die Augen geöffnet.
 mit freundlicher Genehmigung von Tom Körner
mit freundlicher Genehmigung von Tom Körner 






 Rubrik
Rubrik Themen
Themen Der Autor
Der Autor  Datum
Datum Ausgabe Mai 2012
Ausgabe Mai 2012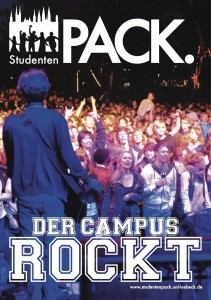
 Mundpropaganda
Mundpropaganda Diskussion
Diskussion  Sonderseiten
Sonderseiten